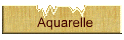|
|
|
|
Ich sitze hier an meinem Schreibtisch mit der Schreibmaschine. Ein weißes Blatt Papier ist eingespannt und freue mich, zu schreiben. Mein Blick ruht auf dem Bogen. Meine Finger sind voller Tatendrang. Sie warten nur noch auf die Befehle, welche Tasten der Schreibmaschine sie zu drücken haben. Es ist der Moment der höchsten Konzentration. Es ist aber auch der Augenblick der totalen Leere, der Leere auf dem Papier, der Leere in meinem Kopf. Das einzige, was mich beherrscht ist eins: ich möchte schreiben. Was, ist mir völlig einerlei. Ich möchte schreiben, eine Geschichte, etwas Dramatisches, Lyrisches, ein Gedicht, eine Erzählung, eine Anekdote, egal, was es auch sein mag. In mir brennt es, Gedanken zu Papier zu bringen, Gedanken, die darauf warten, zum Leben erweckt zu werden. Sie sollen Gestalt annehmen, erzählen von Dingen, von Gestalten, die aus uralter Vergangenheit versteckte Erinnerungen wachrufen, die im Kosmos der Welt unendlich kreisen. Sie sollen berichten von Boten, die aus fernsten Zeiten Gedanken in die meinen pflanzen. So soll in mir entstehen, was ich mit meinem Geist formen, was ich mit meiner Phantasie beseelen kann. Dazu benötige ich aber eine Idee, um die sich ein Geschehen, eine Handlung spinnt - und eine Pointe. Doch meine Gedanken spielen Aufruhr, proben das Chaos! Sie jagen wild durcheinander, suchen nach der Idee, die ich zum Schreiben benötige. Es ist als kramte ich in meinen Wäscheschränken nach einer ganz bestimmten Socke und schmisse dabei alles, was ich im Moment nicht gebrauchen kann, wild hinter mich, ohne zu schauen wohin die Stücke fliegen. Ich bin nur von der Vorstellung dieser einen Socke beseelt, ohne zu realisieren, welches Chaos ich dabei anrichte. Es ist, als suchte ich nach einem ganz bestimmten Strohhalm in einem riesigen Strohhaufen, nach einem, der aussieht, wie alle anderen auch, doch ich suche nach diesem einen, bestimmten Strohhalm, über den ich schreiben will. Ein wildes Brausen verhindert jegliche Ordnung in meinem Kopf. Ich bin nicht in der Lage, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Ich versuche mir Dinge vorzustellen, doch ich weiß nicht welche. Es gibt Milliarden Möglichkeiten im Universum und über eine will ich schreiben - aber über welche? Und nach welchen Kriterien soll ich wählen? Es wetterleuchtet in meinem Gehirn. Geistige Blitze leuchten an meinem inneren Horizont, erhellen für Bruchteile von Momenten die turbulente Szene. Ich erkenne nichts und dennoch weiß ich es. Dort stecken sie, die Ideen, in jenen kurz erhellten Fernen. Ich werfe geistige Netze aus, ohne zu wissen, was ich fangen werde. Dann blitzt es wieder grell auf, und ich sehe etwas und mir ist klar: da war die Socke, nach der ich wie wild wühlte. Da war jener ganz bestimmte Strohhalm, den ich verzweifelt in dem Haufen gesucht habe. Doch das Bild ist fort, bevor ich es erkennen kann. Es fällt zurück ins Chaos, zurück ins Einerlei meiner Gedanken, zurück ins Universum der Ideen. Ich zermartere mein Gehirn. Ich versuche das Verlorengegangene zurückzuholen. Greife dabei wie ein Ertrinkender nach Dingen im Wasser, die nicht vorhanden sind, nach Gegenständen, die mich oben halten, nach einer festen Substanz, an die ich mich klammern kann. Es ist zwecklos. Ich taste ins Leere. Doch dann blitzt es aufs neue. Es ist ein gewaltiger Blitz. Eine grelle Helligkeit erleuchtet die Gedanken um mich her, und ich erkenne, sie ist wieder da! Da ist sie, die Idee, oder zumindest ein Zipfel von ihr. Ich packe zu, greife und lasse nicht mehr los. Dann erschauere ich, wie ich immer erschauer, wenn ich eine Idee habe. Wie aus dem Nichts taucht es auf und ich sehe einen Engel. Enttäuschung macht sich in mir breit, denn es ist Weihnachten und ein Engel ist nichts besonderes. Zumal ich noch am Heiligabend eine entsprechende Geschichte gelesen habe. Traurig wende ich mich von diesem Bild ab. Es gibt unzählige Engelsgeschichten, überall kommen neue dazu, ich habe einfach keine Lust über einen Engel zu schreiben. Was für eine Pointe soll sie auch haben, welche Geschichte? Ich bemühe mich erneut, werfe meine Netze in Gedanken aus, den großen Einfall zu fischen. So sehr ich auch nach einer neuen Ideen suche, das Bild bleibt. Der Engel beherrscht mein Denken, meinen Geist. Das Brausen verschwindet. Das Chaos ordnet sich. Alles Störende tritt in den Hintergrund. Ich kann mich nicht weiter dagegen wehren. Ich merke, der Engel ist meine Idee, mein Einfall. Es liegt nun an mir, den Gedanken weiter zu spinnen. Langsam finde ich mich damit ab. Unwillkürlich betrachte ich ihn mir genauer und bemerke, daß der Engel sich eigenartig verhält. Der Himmelsbote flattert nämlich hilflos zur Erde nieder. Jedermann aber ist bekannt, daß ein Engel als Bote Gottes niemals hilflos ist, nicht flattert, sondern majestätisch schwebt. Diesem Engel geschieht eigenartigerweise beides, er flattert zur Erde nieder und ist hilflos. Tiefes Entsetzen ergreift mich und meine Gedanken, denn ich weiß, daß er sterben wird... ... aber warum? Ein Engel kann doch nicht sterben - außer... ... und da ist auch schon die Geschichte...
Ein fernes Rauschen drang an sein Ohr. Er blickte sich um, konnte aber nichts als Ursache entdecken. "Es kommt ein Wind auf", murmelte er und er begann sich zu beeilen. Es war der 24. Dezember und er wollte rechtzeitig zu Hause sein. Doch das Rauschen nahm zu, wurde stärker und stärker, obwohl sich kein Halm im Winde wiegte. Es wurde zum Brausen und Tosen und ein Licht, das keine Sonne war, kam aus der Höhe. Er blickte hinauf und war geblendet und in dem Licht, das er sah, erkannte er eine Gestalt, die aus den Wolken zu ihm hernieder schwebte. Als sie tiefer flog, erkannte er, daß es ein Engel war, ein Engel allerdings, der hilflos flatternd zur Erden sank. Der Mann ging zu dem Engel hin und wollte ihm helfen. Der Himmelsbote blickte ihn dankbar an. Er atmete kurz und schnell. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn und sein Herz pochte so heftig, daß es ihm schier aus der Brust springen wollte. "Hilf mir!", hauchte der Engel kraftlos. Im selben Moment schwanden dem himmlischen Abgesandten die Sinne. Er sackte in sich zusammen und drohte zu Boden zu stürzen. Geistesgegenwärtig fing ihn der Mann auf und hielt den Engel in seinen Armen. Dann setzte er sich nieder und bettete dessen Haupt an seiner Brust, um ihm Schutz und Geborgenheit zu geben. Wie er aber mit ihm so da saß, fühlte der Mann, dass das gepeinigte Leben des Fremden zu verlöschen drohte. Panik kam in ihm auf, erfüllte ihn vom Kopf bis in die Zehenspitzen. Er saß starr da. Nur wirres Zeug hetzte durch seinen gemarterten Kopf. Es war ihm unmöglich, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige, einen fest zu halten. Es gelang ihm nicht, Ordnung in seinem Kopf herzustellen. So sehr er sich auch mühte, alles in ihm lief wild durcheinander. Nur eine Erkenntnis breitete sich in ihm aus. Es war das Begreifen der eigenen Hilflosigkeit. Er hielt einen Engel in seinen Armen. Und dieser Engel hatte ihn persönlich um Hilfe gebeten. Er aber wußte nicht, was er für ihn tun konnte. Der Mann wollte ihm ja helfen, dem Engel, dem Abgesandten Gottes. Wie oft war er schon in seinem Leben in der Kirche gewesen, hatte mit all den anderen Menschen dort das Vaterunser gebetet, mit starker Stimme "Ein feste Burg ist unser Gott” gesungen, hatte den Herrn gepriesen, ihm für all seine Güte, für das täglich Brot gedankt, hatte am Abendmahl teilgenommen, reichlich Geld in den Klingelbeutel geworfen, was viele bezeugen konnten. Nun hatte ihn Gott heimgesucht, ihn zu prüfen, ob er ehrlich war in seinen Gebeten, ob er ehrlich war in seinen Lobpreisungen, in seinem Dank für Gottes Güte, Barmherzigkeit, ehrlich war in seinem Dank für dessen reiche Gaben. Nun hatte er ihm einen kranken Engel geschickt, daß er ihm helfen sollte. Er, ein einfacher Mann, sollte einem kranken Engel helfen, einem Abgesandten Gottes, wo er nicht einmal wußte, einem kranken Menschen die Qualen zu lindern, geschweige denn, jemanden zu heilen. Er war schließlich kein Arzt! Wie hilft man überhaupt einem Engel? Er wußte es nicht. Dessen Atem aber wurde immer flacher und der Puls flog in raschen, kaum fühlbaren Schlägen. Der Mann wagte kaum daran zu denken, was wäre, wenn er den Engel rettete. Welcher Engel mag das wohl sein? Er ließ seine Blicke über die bewußtlose Gestalt schweifen, doch er sah nichts, woran man den Rang eines Engels erkennen konnte. War es ein niederer Engel, von denen es riesige Heerscharen gab? Aber dafür sah er all zu stattlich aus. War es am Ende sogar einer von den Erzengeln? Bei diesem Gedanken schauerte es ihm. Und er dachte bei sich, was Gott wohl sagen würde, wenn er ihm diesen gewaltigen Dienst erweisen konnte. Er rettete das Leben eines der Erzengel. Es mußte schon ein großer Engel sein, denn ein kleiner hätte nicht eine so gewaltige Lichterscheinung erzeugen können. Der Mann war sich nun sicher, daß es mindestens einer von den höherrangigen Engeln sein müßte und sonnte sich in der Vorstellung, vor Gottes Thron gerufen zu werden. Er hörte die gewaltige Stimme des Herrn, die ihm sagte: "Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Dafür will ich dich reichlich belohnen, dich und alle deine Nachkommen. Sie sollen auf Erden leben, wie im Himmel!” Der Mann aber spürte den schwachen Körper des Engels an seiner Brust. Er fühlte, wie das Leben auf seinem Schoß zu verlöschen drohte. Die Atemstöße wurden schneller, flacher. Bald konnte er den Herzschlag nicht mehr tasten. Eine große Angst befiel ihn. Hier lag ein Engel im Sterben und keiner half ihm. Man mußte doch das Brausen gehört, das gleißende Licht gesehen haben! Es kam keiner und der Engel starb in seinen Armen. Auf einmal ergriff den Mann das Gefühl, sein bester Freund hätte ihn verlassen. Eine endlose Leere breitete sich in ihm aus. Er weinte bitterlich über mehrere Stunden, wie er in seinem ganzen Leben noch nie geweint hatte. Recht spät am Abend kam er nach Hause und dachte immer nur an den sterbenden Engel, der in seinen Armen verging. Irgendwann, lange nach der Bescherung, kurz vor dem Schlafengehen berichtete ihm seine Frau: "Diese asoziale Familie mit den lauten Kindern wird nach Weihnachten geräumt. Du weißt schon, die die Miete nie pünktlich zahlen. Wir können die Wohnung dann neu vermieten." "Das wurde ja auch langsam Zeit", antwortete er, ganz in sein Problem versunken. Eine Frage beschäftigte ihn, über die er in seinem ganzen bisherigen Leben noch nie nachgedacht hatte. Seit der Engel in seinen Armen starb, beherrschte ihn dieser einzige Gedanke: "Wie kann man einem Engel helfen?"
Es lebte einmal ein Kandiszückerchen. Das sah wunderschön aus, als wäre es von einem großen Künstler geschaffen. Ebenmäßig seine Gestalt, die Konturen so klar wie die eines Kristalls und seine Seele strahlte rein wie ein Diamant. Sein Äußeres schimmerte in feiner Bräune und die Sonne brach sich in ihm in tausendfach spiegelndem Glanz. Es wohnte in einem feinen Haus, das allen den Reichtum an Kunstverstand offenbarte, mit dem der Architekt gesegnet war. Die Wände waren leicht geschwungen, schneeweiß und pures Gold verzierte alle Ecken und Erker, Kanten und Fugen. So verspielt es sich indes auch darstellte, die großen weißen Flächen sorgten für Ruhe und Ausgeglichenheit. Um das Haus herum hatte man den Boden mit feinstem Silber ausgeschlagen. Das kostbare Metall wurde tagtäglich von fleißigen Händen stets auf Hochglanz poliert. So konnte sich die aufgehende Sonne in ihm spiegeln. Dann sah es aus, als stünde das Haus in einem See, angefüllt mit reinem Silberwasser. Eines Tages fragte das schöne Kandiszückerchen: "Was ist eigentlich der Sinn meines Hierseins?" Und man antwortete ihm: "Deine Aufgabe ist, den Menschen Schönes zu bringen." Es fragte: "Was kann ich den Menschen Schönes bringen?" Die Antwort lautete: "Die Menschen lieben Süßes. Du hast so viel. Gib ihnen davon!" Die letzten Worte waren noch nicht so recht verklungen, da hob sich das Dach seines Hauses, daß Strahlen der Sonne in das Haus vielen. Sie trafen seinen Körper und ein Leuchten ging von ihm aus. Dann wurde es erfaßt und in schwindelnde Höhen getragen. Es reiste in die Ferne. Am Horizont erblickte es einen See, aus dem seichter Nebel stieg. Im selben Augenblick war es auch schon dort und tauchte in das Wasser ein. Wohlig warm wurde es umspült. Es streckte und reckte sich und dehnte sich so richtig aus. Dabei hatte es das Empfinden, in seinem ureigensten Element zu sein. Und als ihm vor Glückseligkeit fast die Sinne schwanden, begriff es den Sinn seiner Existenz. Dann verspürte es ein Beben und es hob sich der See. Zarte Lippen schlürften vorsichtig von dem heißen Tee und bevor die Tasse wieder festen Boden erreicht hatte, sagte der Mensch: "Das tut gut!"
Eine frische Tasse mit heißem, dampfendem und wunderbar duftendem Kaffee steht vor mir. Ich gebe drei Löffel Kaffeeweißer darauf, weil es mir so schmeckt. Das Pulver sinkt nicht gleich. Es häuft sich weiß auf schwarzem Grund und nimmt dann fast die ganze Tassenoberfläche ein. Ich blicke genauer hin, und sehe eine Welt. Eine Welt, bestehend aus dem Eiland, das ich entstehen ließ mit drei gehäuften Löffeln Staub auf einem schwarzen See. ... Diese Insel kämpft den großen Krieg. Sie trägt den alles entscheidenden Kampf der Welten aus. Sie streitet in dem gewaltigen Gefecht um ihre Existenz, gegen das eigene Verderben, gegen das Ausgelöschtsein von der Karte allem Existenten. Ich sehe gigantische Gebirge mit Tälern und Höhen. Schroffe Steilhänge wechseln sich mit sanften Ebenen ab. Doch an der Küste wütet tosend eine Brandung, und die kräftigen Wogen nagen an ihr von Anbeginn der Zeit. Langsam aber stetig sinkt die Insel tiefer in das Meer. Die stolzen Erhebungen verlieren das Majestätische. Die Ränder der Insel reißen ab und stürzen in die Fluten. Ganz allmählich schrumpft die Welt. Sie ändert ihre Form. Stück für Stück fällt vom mächtigen Berg. Er neigt sein altes Haupt, legt sich nieder. Aus schroffen Graden werden sanfte Hügel. In die weiten Ebenen betten große Seen tief sich ein. Lange Spalten klaffen weit ins Land hinein. Von den Höhen brechen weiter große Brocken tief hinunter in das Meer. Kurz nur werden sie zu Inseln vor der Küste. Ihre Kräfte reichen nicht, denn wütend nagt und frißt die Brandung, reißt sie in die ewig schwarzen Fluten. Übrig bleiben große Buchten wie ausgebissen aus der Welt. Ständig stürzen neue Steine von den Hängen. Alles kämpft. Alles stirbt. Unersättlich nagt die Brandung, und die Insel schrumpft. Wenig bleibt noch von dem einst so stolzen Land. Die letzten Klippen brechen ab. Sie wühlen kurz das Wasser auf … Die Insel ist nicht mehr. Dunkle Strudel kreisen noch und Dampf steigt auf, wo jene alte Erde war. Sie sank hinab, so tief hinab dort in die Fluten. ... Ich nehme meinen Löffel, rühr den Kaffee um - und siehe da, die verschwundene Welt ist für mich ein zweites Mal zu sehen - in andrer Form. Sie färbt das vorher schwarze Meer hellbraun und leiht ihm einen sanften, weichen Duft ...
Wie oft träumten sie davon, einmal groß im Lotto zu gewinnen... ... um einmal eine Reise um die Welt zu machen und die schönsten Plätze dieser Welt besuchen. Geschichte erleben hautnah, wo sie einst geschah. Wenn es ginge, mit der Kapsel hoch im All um die Erde kreisen, oder auch ein U-Boot mieten, um mit ihm in tiefste Meere abzutauchen. Sich nach einem Tropfen köstlichem Wasser lechzend durch den Wüstensand zu schleppen. Berge wollten sie erklimmen, oder in kühlen, dunklen Höhlen durch lange enge Gänge, stille unterirdische Seen bis in die fernsten Winkel mit großem Sachverstand erforschen. Auf undurchdringlichen Pfaden sich durch dichte Regenwälder vorwärts kämpfen, auch träumten sie, daß im ewigen Eis halb erfroren sie durch heftiges Schneetreiben sich vorwärts schlagen, dem Tode trotzend. Vieles wollten sie erleben mit des Geldes reichem Segen. Friedlich bis ans ferne Lebensende von den Zinsen leben, wollten sorglos glücklich sein. Die Rendite sollte reichen, um die Träume zu erleben, Träume die sie hatten, Träume die sie pflegten, immer abends, kurz bevor das große Los gezogen wurde. Ein schönes Haus wollten sie sich bauen, einen Swimmingpool für sie, ein tolles Auto sollte er erhalten. Viele große Kleinigkeiten, teils für sie, teils für ihn, schenkten sie sich beide. Das Leben wollten sie genießen und seinem Chef mit voller Wucht die Meinung sagen, und sie ihm mit dem ganzen Frust der Jahre voller Freude vor die Füße schmeißen. Jedesmal, wenn es Samstag wurde und bevor die Lottozahlen kamen, träumten beide ihren großen Traum. Jeder seinen eigenen, doch gemeinsam träumten sie den einen. Die Gesichter, sie verklärten sich. Dann tauschten sie die graue Alltagswelt mit Farbenpracht in eine Welt der Phantasie. Sie spannen die schon hundertfach gesponnenen Gedanken aufs neue und waren selig. Sie erlebten es zusammen, gaben beide das Geld mit vollen Händen aus und sparten doch den größten Teil. Sie lächelten, wenn sie reisten, waren freudig, wie ihr Haus entstand, eingerichtet mit den Wünschen ihrer Herzen. Ein jedes Mal, bevor das große Los gezogen wurde, sahen sie sich an und wußten, daß sie glücklich waren. Doch das Pech blieb ihnen treu und sie gewannen die Millionen. Die erste Freude hatte sich gelegt, da beschloß man, keinem etwas von dem großen Geld zu sagen. Viel zu viele würde doch nur betteln kommen. Die Frau wollte allerdings die eine, oder auch die andere Ausnahmen machen, die der Mann auf keinen Fall akzeptieren konnte. Aber er im Gegenzug schlug selber ein oder zwei Ausnahmen vor, die sie nicht gelten ließ. Sie stritten viel und heftig über diesen Punkt. Der erste Zwist war so geboren. In allen anderen Dingen einigte man sich auf die gleiche schlimme Weise. Jeder fühlte sich gezwungen, dem Anderen einen Vorteil abzuringen. Längst schon war das Glück dahin. Man stritt und schrie herum, beide nur auf sich bedacht. Die Angst kam über sie und nistete bald schon fest sich ein. Man mußte sparen. Wo blieben sonst die vielen Zinsen? Wovon sollten sie nur später leben? Das Haus geriet zu groß. Ihre schicken Möbel waren ihm zu teuer. Sein neues Auto verschlang für sie zu viel, auch die Reise um die Welt entsprach nicht ihren Träumen. Und für all die viel zu hohen Kosten gaben sie sich gegenseitig Schuld. Sie stritten viel und beide wurden krank. Da spürten sie, was sie versäumten! Von Zeit zu Zeit, so fragten sie sich dann: "Sag, weißt du noch, wie wir gemeinsam träumten...?"
Als erstes bewegte sie nur ihren rechten großen Zeh. Nichts anderes als ihren rechten großen Zeh. Man konnte es durch die Bettdecke erkennen. Lange geschah nichts weiter, man vernahm nur hin und wieder ein leises Knacken der Bettfedern. Das war der Moment, indem der Junge zum erstenmal hinschaute - voller Angst. Er sah die Bewegungen und ihm war klar, daß ein Alptraum von neuem begann. Wie hypnotisiert starrte er auf die Bettdecke, unter der seine Mutter lag. Ihre Augen waren geschlossen. Sie lag auf dem Rücken ohne jegliche Regung. Das Knacken kann noch Stunden dauern, dachte er, aber es wurde häufiger und der Junge wußte, daß der Anfall auch diesmal, wie meistens, sich schnell steigern werde. Wortlos setzte sie sich auf, schlug die Decke zurück und blickte ihn mit diesem eigenartigen glasigen Blick an, der ihn in einen seelischen Abgrund stürzen ließ. Sie stand auf und ging, ohne auch nur ein Wort zu sagen, mit gleichmäßig langsamem Schritt, hin durch die kleine Diele bis zur Wohnungstür und dann zurück in die Wohnküche, wo er saß und sie gelegen hatte. Der Junge tat, als würde er weiter lernen, seine Schularbeiten machen, starrte aber nur auf die bedruckten Seiten in dem aufgeschlagenen Buch vor ihm. Zwei Stunden ging die Mutter schweigsam auf und ab, immer im gleichen Rhythmus, acht bis neun Schritte durch die Küche und vier bis fünf durch die Diele. Und der Junge blickte zwei Stunden lang regungslos auf seine Schulsachen. In seinem Kopf aber brauste es, denn er wollte nichts mitbekommen, von dem was um ihn herum geschah. Doch durch das betäubende Tosen in ihm hörte er laut das monotone Aufsetzten der Füße seiner Mutter auf dem knarrenden Holzfußboden, und er empfand jeden Schritt als schmerzhaften Tritt auf seine Seele. Dann begann sie zu sprechen. "Ihr könnt nichts dafür!" Anfangs leiser und langsamer, aber ganz allmählich aufdrehend, lauter und schneller. "Ihr seid nur aufgehetzt, ihr könnt nichts dafür, sie benutzen euch nur, Papi ist auch aufgehetzt, er ist auch nur ein Werkzeug von ihnen, aber warum macht ihr das alles mit?" Zaghaft fragte der kleine Junge wie schon so oft: "Was?" "Stell dich nicht so dumm, ihr wißt doch beide ganz genau, was ihr macht, man hat euch aufgehetzt, - aber was du nicht wissen kannst, ist: Kennedy wurde nicht ermordet, man hat ihn nur entfernt und ihn in Sicherheit gebracht. Wenn alles vorbei ist, wird er mir helfen. Auf uns kommen große Aufgaben zu, deshalb mischen sie mir auch die Medikamente in das Essen, damit auch ich beschützt bin und nicht an die Presse trete und den anderen alles erzähle. Sie würden mich sonst ermorden. Sie überwachen uns. Über die Steckdosen belauschen sie uns. Sollen sie mich ruhig hören, ja hört mich nur. Meine Worte sind an sie alle gerichtet, die mir das antun. Die wissen, dass ich es weiß!" Diese Reden gingen über Stunden mit immer dem gleichen Inhalt, den gleichen Vorwürfen. Dann drehte sie erst richtig auf. Sie fing an zu schreien. Sie schrie mit ihrer ganzen Kraft, und sie hatte eine laute Stimme. Sie schrie: "Das halte ich nicht mehr aus, das muß doch irgendwann ein Ende haben, warum hören die nicht auf, ich halte es nicht mehr aus... " Der kleine Junge hatte noch einen Bruder, und in aller Regel schloß einer ihrer beiden Söhne spätestens jetzt das Fenster. "Du kannst es ruhig auflassen," schrie sie dann weiter: "die sollen nur hören, was sie angerichtet haben, diese Schweine, einer Mutter von zwei Kindern so etwas anzutun... !" ... und sie schrie und schrie über Stunden... und nachts kam sie weinend an die Betten der Kinder, weckte sie, und machte ihre Gesichter naß mit ihren Tränen. "Ihr geht doch nicht weg von mir, ihr bleibt doch hier und laßt mich nicht allein,... ich liebe euch..." ... und lange Stunden in diesen Nächten lief sie auf... und... ab... und... auf... und... ab... und so ging es mehrmals in der Woche und die Kinder fanden in diesen Nächten kaum Schlaf... Monat für Monat, Jahr für Jahr... und sie verloren ihre Jugend... und sie fingen an, ihre Mutter zu hassen, denn sie verstanden ihre Krankheit nicht... ... mit der Zeit verkrochen sie sich in ihre eigenen kleinen Seelen, die bluteten... doch niemand war da, sie zu verbinden... ... zwanzig Jahre lang haßte der kleine Junge mit den Schularbeiten seine Mutter für das, was sie ihm angetan hatte und zwanzig Jahre lebte er mit dem Gedanken, daß sie besser gestorben wäre. Zwanzig Jahre mußte er sich überwinden, sie zu besuchen, und zwanzig Jahre verursachte allein der Gedanke an sie ein schmerzhaftes Unbehagen. Zwanzig Jahre lang litt er darunter... ... bis er eines Nachts einen Traum hatte... ... er träumte, und er wußte, daß er träumte, er kniete auf dem Fußboden vor dem Bett, in dem seine Mutter lag. Den Kopf hatte er vorgebeugt und das Gesicht in ihrem Schoß vergraben. Er weinte. Er weinte so sehr, daß es ihn zutiefst erschütterte und sich die vielen Krusten in seiner vernarbten Seele zu lösen begannen. Davon wachte er auf und war tief bewegt. Und in der folgenden Nacht träumte er wieder, und er wußte auch diesmal, daß er träumte, und er kniete wieder auf dem Fußboden vor dem Bett, in dem seine Mutter lag. Den Kopf hatte er vorgebeugt und das Gesicht in ihrem Schoß vergraben. Er weinte. Er weinte so sehr, daß es ihn zutiefst erschütterte und sich die vielen Krusten in seiner vernarbten Seele weiter lösen konnten. Davon wachte er auf und war tief bewegt. Und in der dritten Nacht träumte er wieder, und er wußte auch diesmal, daß er träumte, und er kniete wieder auf dem Fußboden vor dem Bett, in dem seine Mutter lag. Den Kopf hatte er vorgebeugt und das Gesicht in ihrem Schoß vergraben. Er weinte. Er weinte so sehr, daß es ihn zutiefst erschütterte und sich die vielen Krusten in seiner vernarbten Seele so weit lösten, daß sich ein kleiner Spalt öffnete und der Haß entweichen konnte. Davon wachte er auf und war unendlich erleichtert. Und abermals zwanzig Jahre später, als er wieder einmal diese Zeilen las, hatte er zum ersten Mal keinen Klos mehr im Hals.
Als Junge träumte Alwin davon, die Gedanken der Anderen lesen zu können. Plötzlich nahm er sie wahr, von einem Tag zum anderen. Er wachte morgens auf, und hörte die Gedanken der Menschen. Zunächst war es nur ein Gemurmel, das er in seiner Wohnung hörte, als liefen in der Nachbarschaft verschiedene Radios und Fernsehgeräte. Auf dem Weg zur Arbeit war ihm, als gingen die Menschen laut redend an ihm vorüber, alle versunken in Selbstgespräche. In der Straßenbahn brandete ihm ein Stimmengewirr entgegen, das genau das Gegenteil war vom typischen morgenmuffligen Schweigen aus dem Schlaf gerissener, zur Arbeit müssender Menschen. Als er sich auf einen freien Platz setzen wollte, stolperte er über die ausgestreckten Beine eines Mannes in Arbeitskleidung. Alwin entschuldigte sich, und beim Hinsetzen vernahm er eine Wüste Schimpfkanonade. Er wollte zurückwettern, hob dazu seinen Kopf, um seinen Unmut wegen der lang ausgestreckten Beine loszuwerden. Da sah er, daß der Mann ihn freundlich anlächelte und "Kann doch jedem passieren.” sagte. Alwin lächelte zurück. Wie er sich aber hinsetzte und dem Mann noch freundlich lächelnd ins Gesicht blickte, vernahm er deutlich wieder das Schimpfen: "Idiot, kannst du nicht aufpassen, wo du hintrittst? Verdammt, es tut höllisch weh!” Alwin sah aber, daß der Mund des Mannes geschlossen war. Wer hatte da auf wen geschimpft? Erstaunt blickte er sich um, und stellte fest, daß keiner seine Lippen bewegte, aber alle sprachen, und wenn er jemanden ansah, dann hörte er dessen Stimme deutlich und gut verständlich. Er hörte Menschen reden, die allem Anschein nach stumm, mit geschlossenen Mündern da saßen. Langsam dämmerte es Alwin, daß mit ihm etwas eigenartiges geschehen war. Er vernahm die Gedanken der anderen. Er hörte sie wie normale Stimmen, die an sein Ohr drangen. Zunächst war er verwirrt. Er lauschte nach rechts und links, er blickte ihnen ins Gesicht, in ihre Augen, provozierte sie zu wilden Gedanken, die sich gegen ihn richteten. Dabei achtete er auf ihre Lippen, doch sie blieben geschlossen. Manchmal lächelten sie sogar, während die schlimmsten Schimpftiraden auf ihn niederprasselten. Alwin lächelte zurück. Nichts hielt ihn mehr auf seinem Platz. Er mußte aufstehen. Langsam ging er durch die Straßenbahn. Bei allen möglichen Leuten blieb er für einen Augenblick stehen, lauschte ihren Gedanken, und berauschte sich an seiner neuen Fähigkeit. Es war aufregend und er dachte bei sich, er käme jetzt hinter das Geheimnis der Menschen. Nun konnte ihm keiner mehr etwas verschweigen. Er war der Herr der Wahrheit, oberster Schützer des Rechts. Niemand konnte ihn belügen. Man würde kommen und ihn um Rat fragen. Lange schon war er an seiner Haltestelle vorbeigefahren. Immer und immer wieder faszinierte ihn, wie er in die intimsten Bereiche der Menschen vordringen konnte, ohne daß sie es merkten. Er hörte, was sie dachten, sah ihre Phantasien. So ging er durch die Straßen und Plätze seiner Stadt voller Wissensdrang und schaute in die Seelen der Menschen. Doch was er sah, war selten erfreulich. In der Regel erblickte er Kummer und Schmerz. Er sah die unendlichen Sorgen, die sie mit sich schleppten. Er empfand die Trauer, die sie bedrückte. Hoffnungslosigkeit höhlte die Menschen aus, und häufig, viel zu häufig schlug ihm die Leere in den Herzen der Menschen mit solcher Macht entgegen, daß sie ihn drohte mitzureißen. Er sah Verzweiflung. Er hörte von der Angst, von der immensen Angst, verlassen zu werden, von der fürchterlichen Angst, abgelehnt zu werden, von der abgrundtiefen Angst allein gelassen zu sterben. Er sah Furcht in ihnen... ... und er sah ihre grenzenlose Einsamkeit. Die Not in den Herzen der Menschen bedrückte ihn. Sie lastete schwer auf seiner Seele. Wohin er auch ging, er konnte sich nicht entziehen. Er litt, wenn er einen Menschen nur ansah. Im selben Augenblick erfuhr er von dessen Schmerzen. Er sah nur Menschen, die litten, jeder auf seine Weise. Er verkroch sich in seiner Wohnung, ging zum Hausarzt. Der lachte innerlich über ihn und nannte ihn einen Simulanten. Laut sagte er etwas anderes und überwies ihn an einen Psychiater. Als dieser erfuhr, daß der Mann die Gedanken der anderen lesen konnte, verzogen sich seine Mundwinkel unmerklich und als er zudem noch erfuhr, daß der Mann die Gedanken in Form von Stimmen vernahm, war ihm klar, daß eine Psychose vorlag und er verschrieb ihm Medikamente, die ihm die Stimmen nehmen sollten. Dankbar nahm sie der Mann. Aber genau so wie jeder nicht taube Mensch Geräusche hören kann, vernahm er weiterhin die Gedanken der Menschen. Keine Arznei konnte das verhindern. Er gab seine Arbeit auf, verließ seine Wohnung und zog durch die Welt auf der Suche nach einem glücklichen Menschen, nach einem Menschen, der nicht litt. Nur einen einzigen wollte er finden. Eines Tages verstand er jenen Menschen, der da gesagt haben soll, er habe die Sünden der Welt auf sich genommen... ... und der Mann spürte ein Kreuz auf seinen Schultern und fühlte, wie es schwerer und schwerer wurde.
Er träumte vom großen Geld... ... seit Jahren schon arbeitete er an dem Plan einer Entführung, und kam zur Schlussfolgerung, dass bei einem derart hohen Risiko vier Vorbedingungen unbedingt erfüllt sein müssten. Andernfalls sänken die Erfolgsaussichten auf ein so niedriges Niveau, dass die ganze Sache sich nicht mehr lohnte. 1. Das Geld. Die Bonität des Erpressten musste vorhanden sein. 2. Das Versteck. Es musste schallsicher sein und niemand durfte es später identifizieren können. 3. Der Informationstransfer. Die Informationen an den Erpressten durften keinerlei Rückschluss zulassen. 4. Die Geldübergabe, das größte Risiko. Der Geldbote hatte absolut neutral zu sein. Er durfte nichts wissen und praktisch nicht zu verfolgen sein. So ging er an die Sache heran, wie an eine knifflige Doktorarbeit. Die theoretischen Vorbedingungen galt es, in die Praxis umzusetzen. Den ersten Punkt übersprang er zunächst. Ein geeignetes Opfer war bestimmt zu finden. Der zweite Punkt erschien ihm schon wesentlich wichtiger, ja von schier immenser Bedeutung. Wie viele Opfer hatten in der Vergangenheit den Entführer entlarvt, nur weil sie die Räumlichkeiten eindeutig wieder erkannten. Deshalb sollte das Opfer nach der Freilassung bei der Vernehmung durch Spezialisten der Kriminalpolizei von seinem Gefängnis ein völlig verkehrtes Bild malen. Er durfte sich dessen selbstverständlich nicht bewusst zu sein. Den Raum hieß es also entsprechend herzurichten. Eine Flucht des Entführten sollte in jedem Fall prinzipiell ausgeschlossen sein. Andernfalls konnte er das Unternehmen gleich abblasen. Bei seinen Fahrten durch die Lande entdeckte er bald günstige Verstecke. In gebirgigen Gegenden, wo alte Häuser an steilen Hängen standen, waren häufig Felsenkeller in den Stein gehauen. Hatten diese dann sogar noch einen direkten Zugang vom Haus, wurden sie zum idealen, weil schalldichten Verlies! Nun galt es, eine entsprechende Immobilie zu finden und preiswert zu erstehen. Das war relativ einfach. In gebirgigen Regionen wurden immer wieder alte Häuser mit Felsenkellern angeboten. Dort boten auch gleich mehrere Makler Objekte mit den gesuchten Merkmalen an. Viele dieser Häuser standen abseits an den Hängen am Rande oder außerhalb der Ortschaften. Den Maklern erzählte er von seiner Sehnsucht nach Abgeschiedenheit, Ruhe und Erholung. Er wählte ein Haus, dessen Felsenkeller die nötige Größe hatte. Meist war die Bausubstanz sehr alt und bedurfte gründlicher Restaurierung. Zunächst ließ er sich Bausteine liefern, mit denen er anfing, ein kleines Gartenmäuerchen rund um das Grundstück zu errichten. Dann wurden leichte Gasbetonsteine angefahren, um eine Garage zu bauen. Diese Steine hatten die passende Größe, dass man sie leicht zu einer Mauer aufeinander schichten konnte. Die Bodenplatte für die Garage ließ er schnell in Beton fertig gießen. So konnte jedermann sehen, dass hier alles seine Richtigkeit hatte. Alles ging mit rechten Dingen zu. Der neue Eigentümer richtete das Haus offensichtlich her. Der Garten verwandelte sich in einen Bauplatz, auf dem überall Paletten mit Steinen herumstanden. Auch im Haus begann er umzubauen, damit es nicht auffiel, dass eine große Anzahl der Gasbetonsteine im Gebäude verschwanden. Außerdem nahm er Kontakt zu seinen Nachbarn auf, trank mit ihnen hier und da ein Gläschen. Er meinte, ein bekannter Mensch würde seltener verdächtigt, als einer, der auf Anonymität bedacht ist. In Wirklichkeit richtete er den Felsenkeller her. Ohne zu mauern schichtete er vor die naturgehauenen Felswände die großen Gasbetonsteine zu senkrechten Wänden. Ein rechteckiger Raum entstand. In jede Wand setzte er eine Tür, um den Eindruck eines in einem größeren Gebäude liegenden Raumes zu erwecken, daher auch fensterlos. Obenauf legte er Holzbalken und montierte eine Decke darüber. Nun sah es nach einem Raum mit einer Balkendecke aus, der sich in einem Neubau befand. Weißgestrichene Raufasertapeten rundeten das Bild ab. Er verlegte einen grauen Teppichboden, wie man ihn häufig zu Gesicht bekommt und an die Wände hängte er Kunstdrucke, deren Rahmen er mit farbigem Klebeband veränderte. So entstand ein Raum, den er nach dem erfolgreichen Coup schnell wieder entfernen, verschwinden lassen konnte, ohne dass eine Spur davon zurückblieb. Er fuhr zu einem fast einhundert Kilometer weit entfernten Militärflughafen. Dort nahm er die Geräusche startender und landender Düsenjäger auf Tonband auf, genau so, wie an einer anderen Stelle das Vorüberdröhnen, eine Brücke überquerender Fernschnellzüge, aber auch das schier endlose Vorbeirattern langer, langsam fahrender Güterzüge auf der selben Brücke. Ebenso nahm er anderenorts das Tuckern eines vorübergleitenden Frachtkahns auf. Das HiFi-bandgerät kam in das Haus, um es von dort aus bedienen zu können. Die Lautsprecher platzierte er im Felsenkeller hinter den aufgeschichteten Wänden, um dem entführten Kind die Geräuschkulisse einer anderen Gegend vorzutäuschen. Zum Einstellen der richtigen Lautstärke, wollte er vor allem auch die Qualität des Eindrucks beim Anhören der Geräusche überprüfen. Er war begeistert. Er saß in dem hergerichteten Raum, und kam sich vor, als befände er sich in der Nähe eines Flughafens unweit einer stark befahrenen Eisenbahnlinie, die direkt am Haus wohl über einen beschiffbaren Fluss oder Kanal führte. Tatsächlich aber befand sich selbst in weiterer Umgebung kein einziger Flughafen, weder ein militärisch, noch zivil genutzter. Auch führte keine stark befahrene Eisenbahnlinie in seiner Nähe vorbei. Einen Fluss oder Kanal gab es genau so wenig. Die akustische Täuschung war perfekt. Die nächste Sache, die er vorbereiten musste, war der Geldbote. Ihm war klar, dass das natürlich kein Mensch sein durfte. Der konnte beobachtet, verhaftet, verhört werden. Eine Maschine musste es sein, eine, die nur ganz schwer zu verfolgen war, eine, die es schaffte, den Verfolgern eine falsche Richtung zu suggerieren. Nachdem er einen höheren Betrag von der Bank geholt hatte, um relativ exakt das Gewicht und die Größe des zu erpressenden Banknotenbündels ausrechnen zu können, bastelte er sich ein ferngesteuertes Modellflugzeug in der nötigen Größe für die zu transportierende Last. Flugübungen führte er im fernen Ausland durch. Er legte sich ein tragbares Faxgerät zu, mit dem er von jedem Telefon aus Nachrichten übermitteln konnte. Dann war es soweit. Er spähte das Kind eines reichen Industriellen aus und entführte es exakt wie geplant. Am selben Tag noch war es in jenem hergerichteten Raum in dem Felsenkeller. In den vier Wänden des Gefängnisses waren Ketten montiert, die in der Mitte des Raumes in einem Ring endeten. Daran war der Junge befestigt. Er hatte gerade so viel Spielraum, dass er keine der Wände berühren konnte. Sonst hätte es möglicherweise beim Versuch, eine der Türen zu öffnen, die Mauern zum Einsturz bringen können. Die Ketten selbst waren in den Felswänden dahinter verankert. Sie ließen dem Kind aber genügend Freiheit, sich im Zimmer bewegen zu können. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch, daneben ein Bett und von der Decke hing eine Schnur, um das Licht ein- und auszuschalten. Buntstifte lagen da, ein Malheft und viele weiße Blätter. Dem entführten Kind sollte es an nichts fehlen. Für Essen und Trinken war reichlich gesorgt. Ein gut bestückter Kühlschrank erfüllte alle diesbezüglichen Wünsche. Auch Knabbersachen und Süßigkeiten waren vorhanden. Eine Campingtoilette stand auf der anderen Seite des Bettes. Dem Kind würde es, den Umständen entsprechend, gut gehen. Ein Fernseher mit Videorecorder und ein Stapel Filme sollten ebenfalls für Ablenkung sorgen. Die Aktion war gestartet. Alles lief reibungslos. Das Modellflugzeug hatte er vorher am beabsichtigten Übergabeort in einer Streusandkiste deponiert, einer, wie sie an Steigungen oftmals stehen. Diese Stelle erreichte der Überbringer des Lösegeldes über eine wahre Stafette von Anweisungen. Der Bote legte dabei eine Entfernung zurück von weit mehr als zweihundert Kilometern. Somit konnte die polizeiliche Überwachung nicht so engmaschig organisiert werden. Schließlich wurde das Geld entsprechend einer vorgefundenen Anweisung in dem Modellflugzeug verstaut. Der Entführer beobachtete alles mit einem Feldstecher aus sicherer Entfernung. Der Start erfolgte mittels einer Relaisstation, die er über seine Fernsteuerung bediente. Zunächst wurde das Flugzeug in eine falsche Richtung geflogen. Als es von etwaigen Beobachtern weit genug entfernt war, lenkte er es in einem weiten Bogen zu sich heran. Das Ziel war ein relativ großer Metallbehälter, den der Entführer mit der Öffnung nach hinten in seinem Kombiwagen mit sich führte. Das Flugzeug flog direkt in ihn hinein, dass es zerbarst. Schnell sammelte er die verstreuten Bruchstücke ein, warf sie in den Kasten dazu, und verschloss ihn sofort. Nun konnte ein eventueller Sender nicht mehr nach außen dringen, um Signale an die Verfolger zu übermitteln. Zu Hause steckte er das Geld in seine Waschmaschine und wusch es gründlich, in der Hoffnung, dass es nicht mehr färbte, falls es entsprechend behandelt worden sein sollte. Dem Kind gab er ein Schlafmittel, fuhr es in eine ganz andere, entfernte Gegend und benachrichtigte die Eltern, die es kurz darauf fanden. Er brachte die Mauersteine aus der Höhle, baute damit die Garage und mit den Deckenbalken des ehemaligen Gefängnisses das Dach. Mit den Türen ersetzte er alte im Gebäude, die Bilder tauschte er durch andere aus, zog die farbigen Klebstreifen von den Rahmen, und verteilte sie im Haus. Nichts deutete jetzt noch auf das vergangene Geschehen hin. Wenige Tage darauf verkaufte er das Haus mit Gewinn. In der Presse verfolgte er gespannt die langsam versiegenden Nachrichten, die stets mit den Worten endeten, dass von den Tätern noch keine Spur zu finden sei. Als es dann eines Abends an seiner Haustür klingelte und er wegen der Entführung verhaftet wurde, brach für ihn eine Welt zusammen. Er leistete keinerlei Gegenwehr, stammelte immer nur "Warum, wieso, ich verstehe nicht, warum... ?" Der Inspektor erklärte es ihm: "Der Junge hat an versteckter Stelle im Kühlschrank seinen vollen Namen geschrieben, ebenso an der Unterseite des Tisches. Die neuen Eigentümer des Hauses entdeckten die Schriften und benachrichtigten die Polizei. Der Rest war Routine."
Von den Haarwurzeln bis in die Zehnägel war er angespannt. Es hatte geklappt. Jahrelanges Planen und Tüfteln zahlten sich aus. Er hörte im Radio in den Frühnachrichten von dem großen Coup und keiner hatte etwas gesehen, keiner was gehört. Es gab keine Zeugen. Die Polizei tappte hilflos im Dunkeln. Doch die Anspannung blieb. Immer und immer wieder ließ er sich jede Kleinigkeit durch den Kopf gehen. Er konnte keinen Fehler entdecken. Er kam dennoch nicht zur Ruhe. Ständig sprang er auf, rannte durch die Wohnung und setzte sich. Ein inneres Kribbeln befiel ihn, etwas das er vor und während der Tat nicht gekannt hatte. Bei der Planung und Durchführung war er hochkonzentriert. Nichts hatte ihn ablenken können. Aber nun diese Unruhe. Er zwang sich, zu entspannen. Zwei Wochen Urlaub hatte er sich genommen für die restliche Planung, die Durchführung und für ein paar Tage danach. Nun war er froh darüber. In diesem Zustand hätte er nicht arbeiten können. So fuhr er an die See, lenkte sich ab. Langsam kehrte Ruhe ein. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, sämtliche Nachrichten zu verfolgen, die immer den gleichen Schluss hatten: "Von dem Täter fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Sie tappt im Dunkeln.” Dann hörte er noch, dass die Versicherung für den Schaden aufgekommen war. Die letzte Meldung hatte mit dem Fall als solchem schon eigentlich nichts mehr zu tun. Sie besagte lediglich, dass sich sein Opfer verspekuliert hatte und Konkurs anmelden musste. Er hatte für sein ganzes Vermögen jede Menge Aktien einer total maroden Firma gekauft, als es hieß, sie werde vermutlich von einem bekannten Konzern übernommen. Die Fusion platzte jedoch. Die Aktien stiegen nicht, wie erwartet, sondern wurden praktisch zu wertlosem Papier, das keiner mehr haben wollte. Der Mann verlor seinen ganzen Besitz. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete der Täter schon längst wieder an seinem gewohnten Arbeitsplatz. Der Urlaub war vorüber. Das Geld lag gut versteckt in seinem Keller. Bisher hatte er noch nichts davon angerührt. Ja nicht auffallen! Das war seine Devise. Bloß keine Ausgaben machen, die andere auf dumme Gedanken bringen könnten! Für jeden Pfennig, den er ausgab, musste er in der Lage sein, Rechenschaft abzulegen. Jede Mark musste belegbar sein. Aber wie kann man geraubtes Geld legalisieren? Er sah nur einen Weg: er musste es als Geschäftseinnahmen versteuern. Denn wenn das Finanzamt selbst bei genauer Prüfung keine Unregelmäßigkeiten nachweisen kann, dann ist das Geld nicht mehr heiß, es ist legal. Mit anderen Worten: es ist gewaschen. Und er begann sich Gedanken über seine Zukunft zu machen. Erstes und oberstes Gebot, das er sich setzte, lautete, niemals illegales Geld auszugeben. Das hieß, er würde zunächst weiter so leben, wie bisher. Der logisch nächste Schritt war demnach die Realisierung einer rechtlich abgesicherten Basis, um unauffällig das geraubte Geld in legales zu verwandeln. Dazu war es erforderlich, ein Geschäft zu gründen. Mindestens mit der gleichen Energie, mit der er seinen großen Coup plante und durchführte, vielleicht sogar mit noch mehr Energie und Sorgfalt, machte er sich über das zukünftige Geschäft Gedanken. Nachdem alles so gut gelaufen war, wollte er es nicht durch eine Dummheit wieder aufs Spiel setzen. Es durfte ihm erneut kein Fehler unterlaufen. Nach reiflicher Überlegung kam er zu dem Schluss, dass es ein Betrieb sein musste, in dem man relativ leicht Gelder schwarz verdienen konnte. Er dachte, wenn man einen Gewinn künstlich klein halten kann, um Steuern zu sparen, dann muss man ihn auch künstlich hoch schrauben können. Ein solcher Gewinn war dann zwar zu versteuern, wurde aber legal. Außerdem hatte er so viel Geld im Keller, dass er gut und gerne auch von der Hälfte leben konnte. Um das Geschäft zu gründen, brauchte er Geld, legales Geld natürlich. Ihm war dabei einerlei, dass die Kredite zurückbezahlt werden mussten, dass reichlich Zinsen zu bedienen waren. Er konnte es sich leisten. Letztendlich hatte er ja "Sicherheiten”. So nahm er Geld bei Banken auf, belieh seine Lebensversicherung, erhielt langfristige Darlehen von Bausparkassen und kündigte einen Sparvertrag. Auf diese Weise bekam er genügend Mittel, um damit völlig offiziell ein Speiserestaurant zu eröffnen. Es gelang ihm, einen exzellenten Koch zu engagieren, der für beste Gaumenqualität geradestand. Die Preise für seine Speisen und Getränke gestaltete er entsprechend den gehobenen, ja Spitzenansprüchen. Für die feierliche Eröffnung steckte er noch einen Batzen Geld in die Werbung. Dann war es soweit. Die Leute kamen. Es kamen Reiche und es kamen Wichtige. Es kam die Presse und das Echo war überwältigend. Sein Lokal wurde in den höchsten Tönen gelobt. Man sprach von fälligen Sternen im Michelin. Das Lokal wurde zum totalen Erfolg. Die Hautevolee gab sich Abend für Abend ein Stelldichein. Freie Tische waren nicht zu haben, nur bei Reservierung möglich. Schnell wurde der Besitzer des Lokals zu einer bekannten Größe. Die Gelder, die er zur Gründung des Restaurants aufgenommen hatte, konnte er innerhalb kürzester Zeit zurückzahlen. Es ging ihm blendend. Er hatte einen geschäftlichen Volltreffer gelandet. Doch langsam begann er sich Sorgen zu machen. Er war wer. Er hatte sich eine gesellschaftliche Stellung erarbeitet. Man lud ihn zu großen Veranstaltungen ein. Auf Bällen war er ein gern gesehener Gast und man bot ihm ehrenvolle Ämter im öffentlichen Leben an. Er wurde Mitglied in exklusiven Clubs. Angst machte sich in ihm breit, Angst das alles wieder zu verlieren. Wenn er nach Geschäftsschluss nach Hause kam, meldete sich in ihm ein ungutes Gefühl. Zunächst nur leicht, doch mit zunehmender Zeit wurde es immer mächtiger und es begann zu nagen und es brannte in ihm. Er wusste genau, was es war. Es war das gestohlene Geld in seinem Keller. Langsam nahm der Keller für ihn die Konturen der Hölle an. Wenn er mal in ihn hinabsteigen, dort etwas holen musste, dann hatte er das Empfinden, er steige zu Satan selbst hinab. Mit der Zeit hielt er es nicht mehr aus. "Das Geld muss weg!” Sagte er sich. Aber er wusste nicht wohin. "Verbrennen!” Durchzuckte es ihn, „der sicherste Weg, es loszuwerden.“ Doch er brachte es nicht über sich, soviel Geld zu vernichten. So blieb es weiter in den dunklen Räumen tief unten in seinem Haus. Seine Qualen steigerten sich, er wurde gereizt, und die Menschen merkten es. Man sprach ihn auf seine Nervosität an, und empfahl ihm, doch mal auszuspannen. Sie wähnten ihn überarbeitet, der Aufbau des Geschäftes habe ihm wohl doch zu viel abverlangt. Für die persönliche Anteilnahme war er dankbar. Doch sein Gewissen peinigte ihn. In ihm kamen Zweifel auf, Zweifel an der Echtheit der Gefühle, die andere ihm entgegen brachten. Zunächst war es nur eine ganz vage Vermutung, die sich aber zusehends als fixe Idee in ihm festsetzte. Langsam begann er zu vermuten, dass seine neuen Bekannten Verdacht schöpften. Wahrscheinlich wussten sie bereits alles. Sie warteten nur noch darauf, wann die Polizei zuschlagen werde! Er traute sich kaum noch hinaus. In ihren Gesichtern sah er die kalte Freundlichkeit, die man verachtungswürdigen Menschen entgegenbrachte. In ihren Stimmen hörte er Ironie und zwischen den Zeilen vernahm er die Botschaft: "Du bist ein Verbrecher, warte nur... !” Und er fühlte Panik in sich aufkeimen. Nur mit äußerster Selbstbeherrschung behielt er seine Fassung. Es gab für ihn nur eine Lösung. "Das Geld muss weg!” Dieser Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Mal dachte er daran, es anonym der Polizei zu schicken, aber sofort schrak er zurück. Er überlegte, dass, wenn die anderen schon Verdacht hegten, die Polizei ihn erst Recht im Visier haben müsse. Es quälte ihn, nicht zu wissen, was und wie viel die anderen ahnten oder wovon sie definitiv Kenntnis hatten. Er litt Höllenpein. Nachts hatte er Träume und in diesen Träumen träumte er von Wiedergutmachung. Doch er wusste nicht wie. Auf welche Weise kann man einen Raub wiedergutmachen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Er wollte das Geld der Kirche stiften oder einem anderen guten Zweck. Doch machte er damit das Geschehene wieder gut? Er sah keine Möglichkeit der Wiedergutmachung. Sich der Polizei stellen, war letztendlich auch keine Lösung. Er litt und quälte sich und es ging ihm immer schlechter und sein Gang war schleppend und seine Haltung gebeugt. Es half alles nichts. Um endlich Ruhe zu finden, musste er von seinem Grundsatz abweichen und das illegale Geld ausgeben, wenn er es nicht vernichten wollte. Eines Morgens wachte er mit einem eigenartigen Lächeln im Gesicht auf. Dann sah man ihn eine geraume Weile gar nicht mehr. Als er wieder auftauchte, besaß er wieder seine alte Vitalität. Er konnte lachen, ging schnellen Schrittes, wie man es von ihm gewohnt war und hatte eine aufrechte, offene Haltung. Alle sahen, sein Urlaub war ein Erfolg. Er hatte sich erholt, und sie freuten sich mit ihm, dass er wieder der Alte war. Nur wenn man ihn genau beobachtete, sah man, dass er zwischendurch immer wieder die Zeitung hervor zog und jedes Mal ein und denselben Artikel im Wirtschaftsteil der Zeitung las. In dieser Meldung wurde von einem kleinen Wunder berichtet, einem Wunder, das einen Geschäftsmann betraf, den eigentlich das Schicksal zwei Mal arg gebeutelt hatte. Einmal wurde er schwer beraubt. Die Versicherung erstattete ihm den Betrag zwar, doch kurze Zeit später hatte er sein ganzes Vermögen ein zweites Mal verloren, weil er sich mit wertlosen Aktien verspekulierte. Was war geschehen? Er erinnerte sich, dass sein Opfer pleite ging, weil es die Aktien einer maroden Firma aufgekauft hatte. Diese Firma existierte in der Tat immer noch, stand aber nun vor dem endgültigen Aus. Nachdem er das erfahren hatte, suchte er unter falscher Identität, geschminkt, mit Brille und aufgeklebtem Bart und falschen Haaren, sein ehemaliges Opfer auf und machte ihm einen Vorschlag. Er sagte, er habe schwarze Gelder aus seinem Geschäft und die wolle er anlegen. Seine Idee sei nun, als stiller Teilhaber in besagte marode Firma, von der sein Gesprächspartner bekanntlich eine große Aktienmenge besäße, Geld zu investieren. Sein Motiv sei, kaputte Firmen wieder flott zu machen, denn das könne sehr lukrativ sein. Dazu müsse aber viel Geld investiert werden. Er schlug nun seinem ehemaligen Opfer vor, einen größeren Betrag in den Betrieb zu investieren. Dieses Geld wolle er ihm gegen Quittierung des halben Betrages dafür zur Verfügung stellen. Im übrigen habe er noch weitere Investoren gefunden, die bereit seien, zu den gleichen Bedingungen ebenfalls einzusteigen. Der Mann willigte ein und man begann die Firma zu sanieren. So floss eine größere Summe in die Firma, was in Geschäftskreisen bekannt wurde. Weitere Geldgeber fanden sich, Kapital floss in die marode Firma, Banken wurden aufmerksam, gaben günstige Kredite, und alle gemeinsam machten das verlorengeglaubte Schiff wieder flott. Das Opfer seines Raubes erklomm aufgrund der Aktienmehrheit den Chefsessel, eine Menge Arbeitsplätze blieben erhalten, und die "Investoren” des ehemaligen Täters wurden zu Teilhabern einer bald Gewinn abwerfenden Firma. Unser Täter selbst blieb bei seinem Feinschmeckerrestaurant, dass er sich ehrlich, ganz mit eigenen Mitteln aufgebaut und erarbeitet hatte. Seine Anteile an der geretteten Firma schickte er seinem ehemaligen Opfer, ohne die wahre Identität zu offenbaren. Der so Beschenkte nahm es als ein Wunder... ... nur ganz tief in seinem Inneren ahnte er den Grund des Wunders, ohne je darüber zu sprechen. Die Versicherung und die Polizei legten den Fall nach geraumer Weile zu den Akten… …nur sein Gewissen meldete sich noch von Zeit zu Zeit und nachts quälte ihn hin und wieder ein Alptraum, aus dem er schweißgebadet aufwachte...
Gedankenverloren schaute er hinaus. Ihn faszinierte, wie nebenan ein altes Haus abgerissen wurde. Es tat ihm leid, denn besagtes Haus kannte er, soweit er denken konnte. Von seinen Eltern wusste er, dass es weit über hundert Jahre alt war. Nun wurde es abgerissen. Ihm war, als nähme man ihm ein Stück seiner Kindheit.
Er sah, wie von der Wucht der Erschütterung der Abrissbirne der Kamin umknickte. Es zerbrachen Fensterscheiben und in den Wänden öffneten sich Risse. Staubwolken ergossen sich daraus, wurden vom Wind erfasst und fort geblasen. Sie wehten in seine Richtung, verwischten ein wenig sein Gesichtsfeld. Ihm war dabei, als kämen sie durch die Fugen des Fensters in sein Zimmer. Dann lösten sich die Wölkchen auf und er konnte wieder den Geschehnissen auf dem Nachbargrundstück folgen. Ein alter Bagger schwenkte den Ausleger, an dem die gewaltige eiserne Kugel hing, und die Kugel schwang mit. Sie fuhr krachend in das alte Gemäuer, das barst und bebte, aber dennoch standhielt. Und wieder holte der Bagger aus und schwenkte den Arm zu neuem Schlag. Die stählerne Kugel folgte der Kette, an der sie hing und fuhr abermals mit solcher Wucht ins Haus, dass Steine flogen und die Balken brachen. Große Löcher schlug sie, gleich Wunden eines schweren Kampfes. Und der Mann stand fasziniert an seinem Fenster und schaute hinüber. Er sah, wie Stein um Stein, Balken um Balken das alte Haus in sich zusammenbrach. Dann lag es vor ihm, nur noch ein Haufen Schutt, aus dem hier und da noch ein Holz ragte. Darüber hing im fahlen Licht des langsam vergehenden Tages die stählerne Kugel als Triumphator über das Vergangene. Bald würde kein Mensch mehr über das Haus sprechen, das hier einmal stand. In Kürze wird wohl ein neues auf gleichem Boden entstehen, und andere Menschen werden darin wohnen. Lange noch blieb er am Fenster stehen und hing seinen Gedanken nach. Der Tag wich allmählich der Nacht. Dunkelheit senkte sich auf das Geschehen. Sie hüllte es ein, wie in ein schwarzes Tuch, das es bedeckte, bis es sich seinen Blicken entzogen hatte. Das bleiche Licht der Straßenlampe war zu schwach, um durch die Alleebäume zu dringen und das Grundstück zu erleuchten. Lange noch blickte er hinüber und ihm war dabei, als wäre das ganze Nachbargrundstück ein einziges schwarzes Loch, durch das man ins All schauen konnte, weit hinter die letzten Sterne, tief in das dunkle Nichts. Dann wendete er sich ab und dem Fernseher zu, der hinter ihm die ganze Zeit weiter gelaufen war und sein Programm abspulte, einerlei ob ihm jemand zuschaute oder nicht. Langsam setzte er sich in den großen Sessel. Automatisch nahm er gleichzeitig das Programmheft vom kleinen Tischchen daneben. Mittlerweile war es im Zimmer viel zu dunkel, um richtig lesen zu können. So knipste er die alte Stehlampe an, die mit ihrem Ungetüm von einem welligen, mit brokatähnlichem Stoff bezogenen Lampenschirm und einer viel zu schwachen Birne den Versuch unternahm, die Ecke in ein zum Lesen einigermaßen angenehmes Licht zu tauchen. Er blickte in das Heft, ohne aufzunehmen, was er las, denn in Gedanken nahm er Abschied von einem Stück vertrauter Vergangenheit. Sein bisheriges Leben war gekennzeichnet vom Abschiednehmen. Als kleiner Junge musste er sich von seinem Vater verabschieden, der bei einem Unfall ums Leben kam. Von seiner Mutter nahm er einige Jahre später Abschied. Sie hatte Krebs und starb. Er nahm Abschied von dem Haus seiner Kindheit und zog in das seiner Großmutter. Dann starb auch sie und er blieb allein. So verkroch sich seine Seele und er lebte alleine mit sich, zurückgezogen von der Welt. Nun wurde ihm wieder etwas genommen. Ein neuer Abschied war zu verwinden. Es war das Haus seiner Eltern, das an diesem Nachmittag vor seinen Augen abgerissen wurde. Es war das Haus seiner Kindheit, das er fallen sah. Dort hatte er die ersten Jahre seines Lebens verbracht, hatte gelacht und mit seinen Eltern gelebt. Als er zu seiner Großmutter kam, wurde es zwar verkauft, und fremde Menschen lebten darin, doch nun war es gar nicht mehr. Der Tag verging. Das Fernsehprogramm flimmerte ins Zimmer. Er blickte hin. Dennoch sah er nichts. Er dachte an dem Geschehen im Fernseher vorbei, war weit in seine eigene Vergangenheit abgetaucht und suchte nach Fäden aus dem Damals zum Heute. Irgendwann hörte er zum ersten Mal dieses leise "Huch!” Gefolgt von einem ebenso leisen Lachen, das ein wenig verlegen klang, ein Lachen, das wohl das eigene Erschrecken über jenes "Huch” verdecken sollte. Er blickte auf. Im Fernseher sprach ein Mann einen längeren Kommentar zu einem völlig langweiligen politischen Ereignis. "Auf der Straße vielleicht”, murmelte er vor sich hin. Er hörte erneut dieses "Huch” und war sich nun sicher, dass es aus der gegenüberliegenden Ecke seines Zimmers kam. Er blickte ganz scharf hinüber, konnte aber nichts erkennen. Dann vernahm er wieder dieses leise Lachen, bei dessen Klang ihm anders in der Brust wurde. Es ging ihm durch und durch und er fühle ein Stechen genau in der Gegend seines Herzens. "Wo bist du?” Fragte er, obwohl er genau wusste, dass er allein in seinem Zimmer war und die Stimme von der Straße heraufschallen musste. Ihm war bald klar, dass ihm seine Sinne einen Schabernack spielten. Er spielte mit. In seiner Phantasie ging er davon aus, dass da ein hübsches Mädchen war. Er freute sich, dass er auf andere Gedanken kam. "Komm zu mir”, flüstert er ganz leise, aus Angst, man könne ihn draußen vor dem Haus hören, wie er in seniler Weise Selbstgespräche führte. Dann hörte er abermals das Lachen. Es war nicht mehr so unsicher und ihm lief ein Schauer den Rücken hinunter, als er merkte, es kam näher. Aber er sah immer noch nichts und die Stimme sagte: "Da bin ich!” Es folgte ein neues Lachen und das Lachen kreiste um ihn herum. Er drehte und wendet sich, konnte aber niemanden sehen. Sein Herz jedoch improvisierte einen Indianertanz. Immer wieder vernahm er das Lachen. Wenn das Lachen erklang, wie der feine Ton einer hellen Glocke, dann lachte er mit und die Zeit verging. Bis sie sagte: "Wir sehen uns wieder...” In seinen Ohren hörte er noch lange jenes herzerschütternde Lachen. Dann schlief er ein in seinem Sessel. Er schlief die ganze Nacht, bis er am nächsten Morgen aufwachte. Ihm fiel sofort der Traum vom Abend ein mit dem glockenhellen Lachen und der feinen Stimme, die mit ihm gesprochen hatte. Den ganzen Tag über ging ihm der Traum nicht aus dem Kopf. Er wusste, er hatte nur geträumt und doch war da immer noch jener Schmerz in seinem Herzen, wenn er nur an ihre Stimme dachte. Der Tag verging, der Abend kam. Das Fernsehprogramm war langweilig, wie immer und dennoch schaute er sich die Sendungen an, wie an jedem Abend. Er dachte über sich nach und Wehmut befiel ihn, wenn er an sein bisheriges Leben dachte. Er fürchtete Einsamkeit, wenn er seine Zukunft sah. Ein Krimi lief, den er schon dreimal gesehen hatte und plötzlich war es wieder da - er hörte das Lachen, dieses unbeschreibliche Lachen, von dem er letzte Nacht geträumt hatte. Jenes Lachen, das ihm den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gehen wollte und er wusste nun, dass er nicht geträumt hatte letzte Nacht. Er musste ein unbeschreiblich dummes Gesicht gemacht haben, denn nun erschallte ein herzerfrischendes, lautes Lachen und dieses Lachen war unheimlich ansteckend. Er lachte mit und die Spannung war hinaus. Er atmete befreit auf und in das Lachen hinein hörte er ihre Stimme: "Ich sagte dir doch, dass wir uns wieder sehen!” Im selben Moment hörte er auf, zu Lachen, blickte sich um und stammelte: "Ich seh` dich nicht, wo bist du?” und schmerzhaft zog sich etwas in seiner Brust zusammen. Dann war ein Moment Schweigen und er bekam ein Gefühl für die Zeit in der Ewigkeit. "Gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß”, kichert die Stimme und die Ewigkeit war vorbei und das Leben ging weiter. Sie sprachen und lachten noch viel in dieser Nacht, bis er wieder das: "Wir sehen uns wieder...” hörte und die Stimme fort war und er allein in seinem Sessel saß. Er sah nicht den bunte Bilder produzierenden Fernseher. Er wusste nicht, dass die Lampe noch brannte. Er saß da, tief in seine Gedanken versunken, den Erinnerungen dieser und letzter Nacht nachhängend. Er schlief ein, in dem gleichen Sessel sitzend und wusste am nächsten Morgen nicht, ob er das, was er geträumt hatte, tatsächlich geträumt oder am Ende sogar erlebt hatte. Er entscheidet sich für den Traum, denn sonst hätte er es nicht ausgehalten. Auf der Arbeit fiel es trotzdem auf und einer fragte ihn auf den Kopf zu, ob er verliebt sei, was er unschwer mit der Gegenfrage verneinen konnte: "In wen denn...?” Der Tag verging und als der Abend kam, wurde er unruhig. Es wurde später, er ging im Zimmer auf und ab und dann lachte er auf und rief in den Raum hinein mit lauter Stimme: "Das ist doch lachhaft!” Die draußen vorbeigehenden Passanten wendeten erstaunt die Köpfe, schauten hinauf zu seinem offen stehenden Fenster, doch es geschah nichts und ohne weiter von dem Ausruf Notiz zu nehmen, setzten sie ihre Wege fort und vergaßen das Geschehen im selben Moment. Er schaltete den Fernseher ein. Auch heute nahm er nichts wahr, was da gesendet wurde. Ihm ging das helle Lachen nicht aus dem Sinn. Er saß in seinem Sessel und wartete, doch kein Lachen erschallte, kein "Huch” ertönte. Er saß da und wusste vor lauter Nervosität nicht, was er tun oder denken sollte. Die Zeit kroch dahin. Immer wieder schaute er zur Uhr. Doch die Zeiger schienen festgeklebt. Wohl hörte er das Ticken, nur es bewegte sich kein Zeiger. Und dann war es doch wieder da, dieses zauberhafte, zart gehauchte "Huch” mit dem anschließenden himmlischen Lachen und er war schlagartig hellwach. Sein Herz pochte ihm bis zum Hals. Es machte freudentaumelige Galoppsprünge und schlug in seiner Brust Purzelbäume. Sie lachten viel in dieser Nacht. Doch dann nahm er seinen ganzen Mut zusammen und sagte: "Ich will dich einmal sehen.” Und sie antwortet ihm: "Ich bin sehr hässlich. Wenn du mich auch nur einmal siehst, wirst du nie mehr lachen können.” Er aber antwortet ihr: "Ich liebe dich. Du kannst nicht hässlich sein!” Daraufhin erscheint sie ihm. Sie war, weiß Gott, der Abgrund alles Hässlichen. Er schaute sie an. Dabei sah er nur ihre Augen und die strahlten ihn an, wie eine doppelte Venus an einem sternklaren Winterhimmel. Sie blitzten zu ihm hinüber und er schaute tief in das All bis weit hinter die letzten Sterne, dort wo Liebe und Zeit eins werden und noch weiter in die schwarze Tiefe, wo diese Einheit sich mit den Seelen aller Einsamen verbindet. Dort erkannte er, dass keine Seele, und ist sie noch so geschunden, einsam bleibt. Am nächsten Morgen wachte er wieder in seinem Sessel auf und diesmal wusste er, dass er nicht geträumt hatte. Denn er hatte sie gesehen! Er wusste nun, wie sie aussah. Sie war bildschön, hatte wunderbare Augen, ihr Mund war weich und wohl geschwungen. Ihre Wangen beherbergten ein kleines Grübchen und in der Mitte des Gesichts saß ein kleines, freches Stubsnäschen. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit ging er aufrecht zur Arbeit. Zum ersten Mal blickte er den Menschen in ihre Gesichter. Er sah seine Kollegen im Büro und schaut zum ersten Mal zur unscheinbaren Kollegin am Nachbarschreibtisch hinüber. Nur für einen Augenblick trafen sich ihre Blicke. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel erschlug es ihn fast. Er stand da, wie vom Donner gerührt, unfähig auch nur ein Glied zu rühren. Er stand da und starrte in ihre Augen. Die aber strahlten ihn an, wie eine doppelte Venus an einem sternklaren Winterhimmel. Sie blitzten zu ihm hinüber und er schaute tief in das All bis weit hinter die letzten Sterne, dort wo Liebe und Zeit eins werden und noch weiter in die schwarze Tiefe, wo diese Einheit sich mit den Seelen aller Einsamen verbindet. Er sah ihren Mund, er sah die Grübchen in ihren Wangen und er sah auch das kleine, freche Stupsnäschen in der Mitte ihres Gesichts. Und sie schaute ihn an und ihr Mund öffnete sich und sie lächelte und sie sagte "Hallo Peter!” ... und er hört ihre Stimme ...
Die Menschen drängten sich in den Gerichtssaal. Alle waren bis zum Äußersten gespannt. Zum ersten Mal konnte die "Neue Rechtsprechung” zur Anwendung kommen. Bereits als die Überlegungen in dieser Richtung begannen, bildeten sich zwei Lager. Die Befürworter, sowie die Gegner. Die Ersteren feierten das "Neue Recht” als einen Meilenstein, als ein echtes Abschreckungs- und Läuterungsmittel, das auch funktioniert, weil es dem Täter in direkter Weise vorführt, was er getan hat. Die anderen empfanden es zu brutal und lehnten es als unmenschlich ab. Das Recht spiegelte den Satz wider: "Wie du mir, so ich dir.” Der Täter sollte das Gleiche erleiden, was er seinem Opfer angetan hatte, frei nach dem alten Testament: "Auge um Auge, Zahn um Zahn”. In diesem Fall ging es aber nicht nur darum, dass zum ersten Mal ein Urteil auf der Basis dieses "Neuen Rechts” gefällt wurde. Es ging vor allem auch um die Abscheulichkeit der Tat. Der Täter musste seine Opfer lange gequält und seine sadistischen Veranlagungen in vollen Zügen ausgekostet haben. Er hatte sie gefoltert und gepeinigt. Er hatte seine perversen sexuellen Gelüste in exzessiver Weise an ihnen ausgetobt. Er hat sie geschunden, bis sie den Tod als eine Gnade empfanden. Er bestritt die Tat. Erst als man ihm eine lückenlose Indizienkette präsentierte, brach er zusammen, weinte und bat die Richter um Gnade und ein mildes Urteil. Er habe nicht anders gekonnt. Es sei einfach so über ihn gekommen. Eigentlich wisse er auch gar nicht, was geschehen sei. In der Presse berichtete man überschwänglich über die Taten des Ungeheuers und malte in schillernsten Farben und in allen Einzelheiten das gesamte Drama nach. Die Menschen verschlangen die Berichte und ergötzten sich an dem Blut, das andere ließen. Ihre Augen glänzten, wenn sie im Alkoholdunst am Stammtisch sich ausmalten, was der Wüterich sonst noch alles mit den Getöteten angestellt haben mochte, bevor sie starben. Sie diskutierten über Einzelheiten, die der Presse aus gutem Grund nicht mitgeteilt wurden, aber dennoch durchgesickert waren. Alles fieberte auf den Tag der Urteilsverkündung zu. Es sollte der vorläufige Höhepunkt eines weltweit die Schlagzeilen liefernden Spektakels werden. Keiner sprach mehr von den Opfern. Keiner dachte auch nur eine einzige Sekunde an ihr Leid. Von den trauernden Angehörigen sah und hörte man nichts. Wer wollte das schon lesen. Nur eins interessierte noch: das Drama um den Täter. Vor dem Gerichtsgebäude standen die Massen und skandierten immer und immer wieder: "Wie du mir - so ich dir!” und: "Urteil nach dem Neuen Recht! Wir fordern Urteil nach dem Neuen Recht!” Sie steigerten sich hinein. Sie wollten Blut. In ihren Gesichtern sah man seine Augen, seinen verzerrten Mund. Ein zufälliger Beobachter würde jeden einzelnen für den Täter halten. Doch sie fühlten sich im Recht und forderten seinen Kopf. Die Presse schürte das Feuer, blies in die Glut und entfachte einen Brand, der über die Welt ging. Der Menschheit Seele kochte. Doch der Prozess dauerte an, erstreckte sich über viele Monate und füllte die Spalten der einschlägigen Publikationen. Erst als keiner mehr darüber lesen wollte, schwenkte die Presse um. Man begann die bevorstehenden Leiden des Täters auszumalen, denn kein Mensch habe das Recht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die Stimmung in der Bevölkerung schlug um. Man bedauerte nun den Mörder für den Fall, dass er verurteilt würde, dass er verurteilt würde nach dem Neuen Recht. Was hätte dieser arme Mensch dann zu leiden, bis es vorüber wäre. Die Menschen interessierten sich wieder für den Fall. Eine heiße Diskussion entbrannte erneut. Viele waren dafür, viele aber auch dagegen. Langsam legte die Zeit den Schleier des Vergessens über die Köpfe der Menschen. Vor lauter Mitleid mit dem Täter vergaß man die Opfer. Der Tag der Urteilsverkündung kam und die Spannung erreichte ihren Höhepunkt. Wie wird es ausfallen? Der Richter stand auf und verkündete das Urteil im Namen des Volkes. Er hatte die Opfer nicht vergessen. Er urteilte mit bebender Stimme: "Der Angeklagte wird dazu verurteilt, das gleiche Schicksal zu erleiden, wie seine Opfer, welche durch grauenvolle Morde qualvoll zu Tode kamen.” Nach einem Augenblick des Schreckens brach ein Tumult im Gerichtssaal los, den die Ordnungshüter nur schwer unter Kontrolle bringen konnten. Vor nahezu allen Bildschirmen der ganzen Welt nahmen die Menschen Anteil an der Brutalität des Urteils. Es wurde still um den Täter und man hörte lange Zeit nichts mehr über den Fall, denn es dauerte Jahre, bis der Verurteilte sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft hatte. Kein Weg führte mehr an der Vollstreckung des Urteils vorbei. Dann stand der Tag der Vollstreckung fest. Eine Hundertschaft der Polizei rückte an, schirmte hermetisch das Gefängnis ab. In den nahen Polizeikasernen harrten weitere Hundertschaften in Alarmbereitschaft, um notfalls einzugreifen.
Vor der Justizvollzugsanstalt, in der das Urteil vollstreckt werden sollte, waberte die Menge. Sie wartete. Daneben warfen Demonstranten, laut ihrem Unmut Luft machend, mit Steinen Fensterscheiben des Gerichtsgebäudes ein. Der Mann war dazu verurteilt worden, in allen Einzelheiten genau das gleiche zu erleben, was er seinen Opfern angetan hatte. Im Gebäude, im Krankentrakt, wurden die letzten Vorbereitungen getroffen. Der Verurteilte wurde auf die Liege gelegt und angeschnallt. Einer der beteiligten Ärzte gab ihm die Spritze, die ihn in einen Dämmerzustand versetzte. Ihm wurden Elektroden angelegt und dann schaltete der Chefarzt die Apparaturen ein. Der Mörder erlebte nun, selbst als Opfer seiner eigenen Gräueltaten, einen Alptraum. Er machte die Qualen seiner Opfer durch und er wurde lange von sich selbst gequält. So erlebte er in diesem Traum am eigenen Leibe die Auswirkungen seiner sadistischen Veranlagungen, die er als Täter in vollen Zügen ausgekostet hatte. Er hatte sie gequält und gepeinigt, und nun quälte er sich selbst und er peinigte sich in gleichem Maße, so wie er seine perversen sexuellen Gelüste in exzessiver Weise an ihnen ausgetobt hatte. Er hatte sie geschunden, bis sie den Tod als eine Gnade empfanden... ... aber er selbst starb nicht, er empfand jeden Schmerz seiner Opfer am eigenen Leibe, bei vollem Bewusstsein. Jedes Mal, wenn er den anschließenden Tod als Gnade empfand, in der Hoffnung dass alles nun vorüber sei, begann das nächste Martyrium. Dann begannen die Qualen des nächsten Opfers, und er sehnte sich erneut den eigenen Tod herbei. Doch er konnte nicht sterben. Er träumte, aber ihm war, als geschähe alles tatsächlich. Als er erwachte, war jede Einzelheit unauslöschlich Teil seiner eigenen Vergangenheit, wurde unwiderrufliches Kainsmal, tief eingebrannt in seine Seele.
Die Zeit war schwer. Man schrieb das Jahr 1915 und Lydia war 25 Jahre alt, als ihr Kind Felicitas das Licht der Welt erblickte. Der erste der beiden größten Kriege brauste gerade tobend dahin und schlachtete Millionen und aber Millionen von Menschen wie Vieh. Sie blieben auf den Feldern, auf denen die Ehre wuchs. Sie ließen ihre Arme und Beine auf den Äckern, die sie mit ihrem Blut tränkten, oder sie hatten Glück und kehrten lebend nach Hause zurück als Krüppel und Gebrandmarkte, einige wenige scheinbar unversehrt. Die Frauen aber dankten dann dem lieben Gott für dessen Gnade, den Mann nicht getötet zurückerhalten zu haben, und sie zürnten Gott nicht, dass er Kriege zulässt. Lydia hatte Glück. Ihr Mann, Besitzer einer Apotheke, wurde nicht zum Wehrdienst herangezogen. Und während der Krieg noch tobte und Menschen starben, ging sie mit ihrem zweiten Kinde schwanger. Am vierhundertsten Reformationstag um sechs Uhr morgens, unter dem Klang der Posaunen von der nahe gelegenen Petrikirche konnte ihre zweite Tochter, Margarete, ihr hiesiges Dasein beginnen. Lydias Zuhause war das Baltikum, sie lebte in Riga, der Hauptstadt von Lettland. Sie war eine Frau, die resolut ihren Weg ging, aber sie war auch voller Liebe und Hilfsbereitschaft. In diesem Sinne zog sie mit strenger Hand ihre Kinder auf. So wuchsen die beiden Mädchen heran, wurden zu jungen Damen, heirateten, zogen aus dem Haus und bekamen eigene Kinder. Es kam zum zweiten Weltkrieg und der warf, wie bei so unendlich Vielen auf dieser Welt, seine Schatten über das weitere Leben. Hitler verschacherte das Baltikum, Lydia und ihr Mann mussten umsiedeln. Sie verlor ihren Mann. Auch dieser Tod war als eine Folge des allgemeinen menschenverachtenden Irrsinns zu betrachten. Nach dem Krieg fand sie sich im Westen wieder und hatte alles verloren. Der Mann ihrer älteren Tochter, die inzwischen zwei Kinder von ihm hatte, kehrte nicht aus dem Wahnsinn zurück. Felicitas und ihre beiden Söhne zogen mit Lydia zusammen, nachdem das große Gemetzel vorüber war. Als junge Witwe begann Felicitas zu studieren und wurde Architektin. Ihre Mutter half bei der Versorgung und Erziehung der Jungen. Die Zeit verging. Die beiden Söhne bekamen noch ein Schwesterchen. Alle drei wurden tagsüber von der Großmutter behütet, während Felicitas zur Arbeit ging. Dann baute sie ein Haus für sich und ihre Familie mit ihrer Mutter, der Omi für ihre Kinder, den Hort, die gute Adresse für kleine, zarte Kinderseelen. Die Jahre flogen dahin, die Kleinen wurden flügge. Nach und nach entwickelten sich daraus erwachsene Männer und eine hübsche Frau. Einer verließ das Haus. Der andere blieb, er heiratete und hatte bald selber einen Sohn. Wieder war die Omi zur Stelle, wieder war ihre Hilfe gefragt und sie tat weiter das, wofür sie geschaffen war. Sie lebte für die Kinder und Kindeskinder. Ihre Enkelin ging noch zur Schule, doch schon zog sie die nächste Generation auf. Ohne von ihrer Überzeugung abzuweichen, führte sie ihr Werk zu Ende, bis auch der Urenkel das Haus verlassen hatte. Leere breitete sich nun in ihr aus. Es war die Leere nach geleisteter Arbeit, der verdiente Feierabend nach vollendeter Tat. Die Leere nach einem Leben voller Qualen aber unendlich vielen guten Momenten. Die Leere, die eine Befreiung ist, die eine Besinnung auf sich selbst ermöglichte. Doch diese Leere erschlug sie auch. Sie litt fürchterlich. Ihr so ereignisreiches Leben neigte sich dem Ende zu - und nun diese Leere. Eine panische Angst breitete sich in ihr aus. Sie merkte, dass ein letzter Kampf bevorstand und sie wusste, dass sie ihn nicht gewinnen konnte. Die letzte Schlacht jenes Krieges, der Leben heißt, war schrecklich und qualvoll. Sie unterlag, Gefecht um Gefecht, und der stete Rückzug ließ sich weder stoppen noch verlangsamen. Er vollzog sich unaufhaltsam. Sie verlor ihr Gedächtnis, Erinnerung um Erinnerung schwand, kaum, dass sie noch begriff, was um sie vor sich vorging, bis sie zuletzt auch ihr eigenes Fleisch und Blut nicht mehr erkannte. Dann aber breitete sich Ruhe in ihr aus, ganz tief in ihrem Inneren. Es war die Ruhe nach dem Sturm des Lebens. Die Ruhe, die man braucht, im eigenen Herzen zu erfassen, zu bewerten, zu erkennen. Die Ruhe zur Meditation... ... über sich, die Welt und Gott... ... Über sich und Gott... ... Über... Stille breitete sich nun in ihr aus, eine Stille, die zu der befreienden Leere, der meditativen Ruhe kam. Es war die friedliche Stille nach einem ereignisreichen Leben. Es war die gnadenvolle Stille, die sie auf ihrem letzten Weg schützte, damit sie ungestört ganz tief in sich gehen konnte. Und sie ging in ihre Seele und verfolgte ihr eigenes Leben und wanderte langsam, Schritt für Schritt, zu ihren eigenen Wurzeln und als sie dort ankam starb sie. Wenige Tage nach ihrem 95. Geburtstag. Lydia lebt weiter in den Seelen derer, die sie kannten, und sie hat ihre Spur hinterlassen als Teil im Ganzen. * Zur Erinnerung an Omis 10. Todestag
|
|
Copyright (c) 2007 udo kaemmerling. Alle Rechte vorbehalten. |